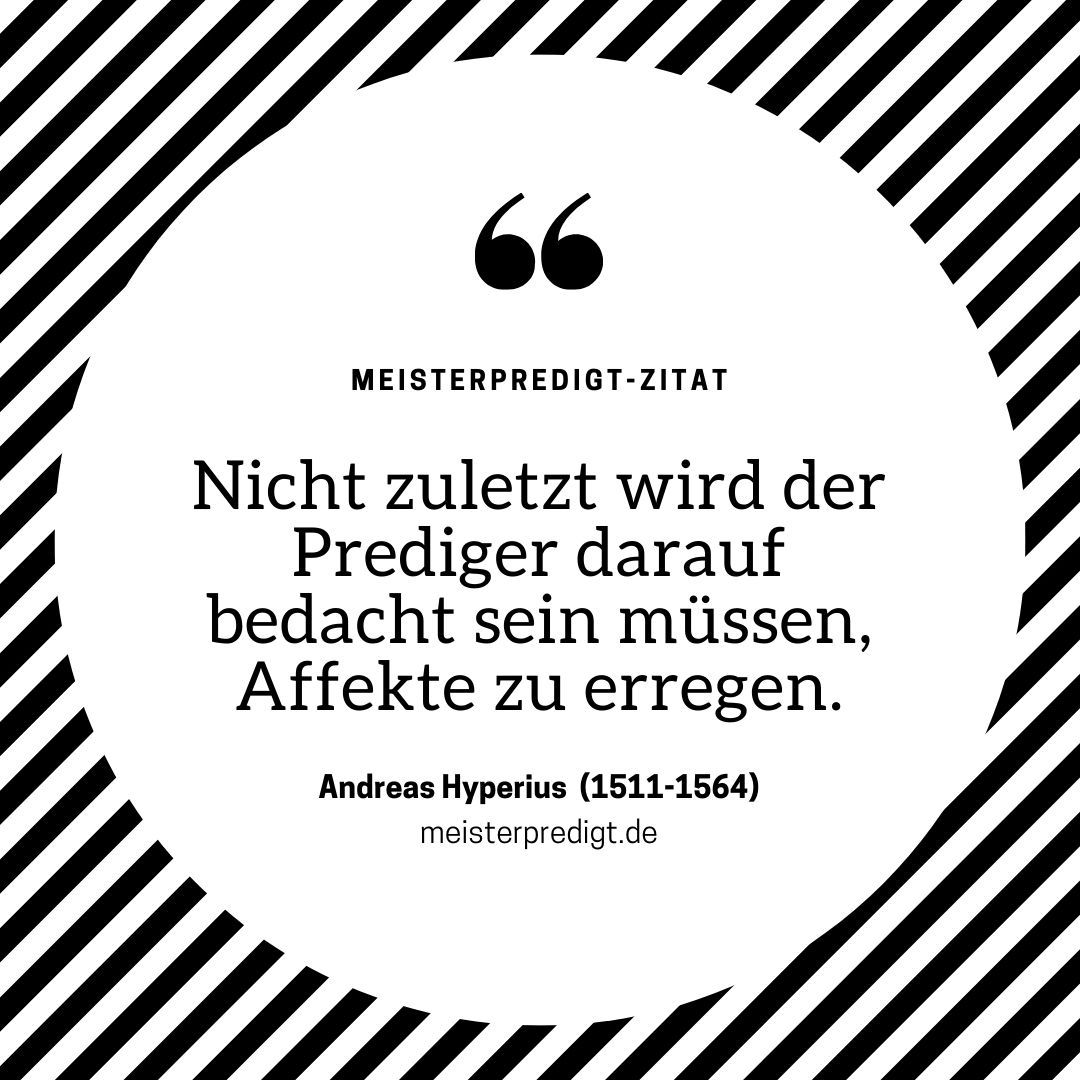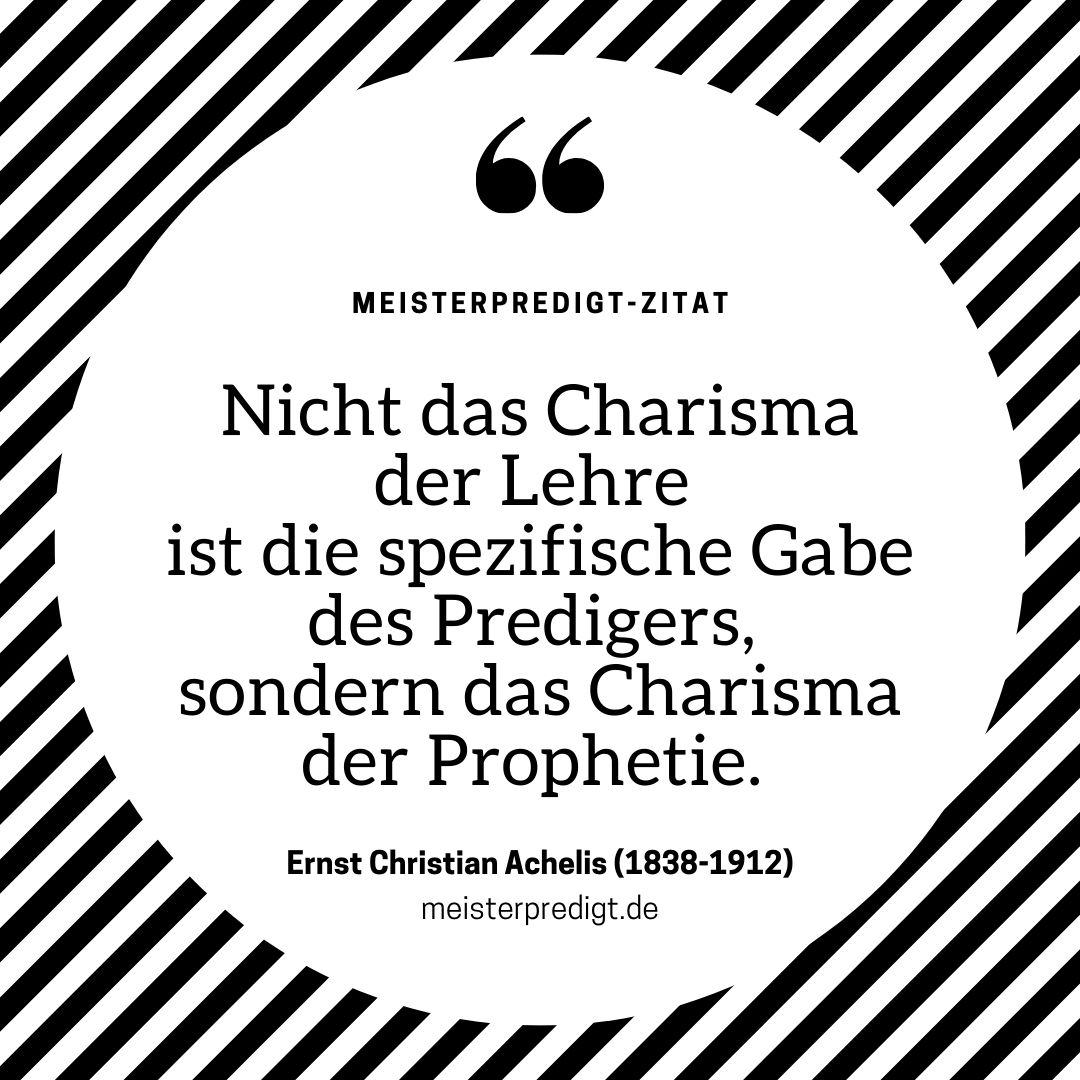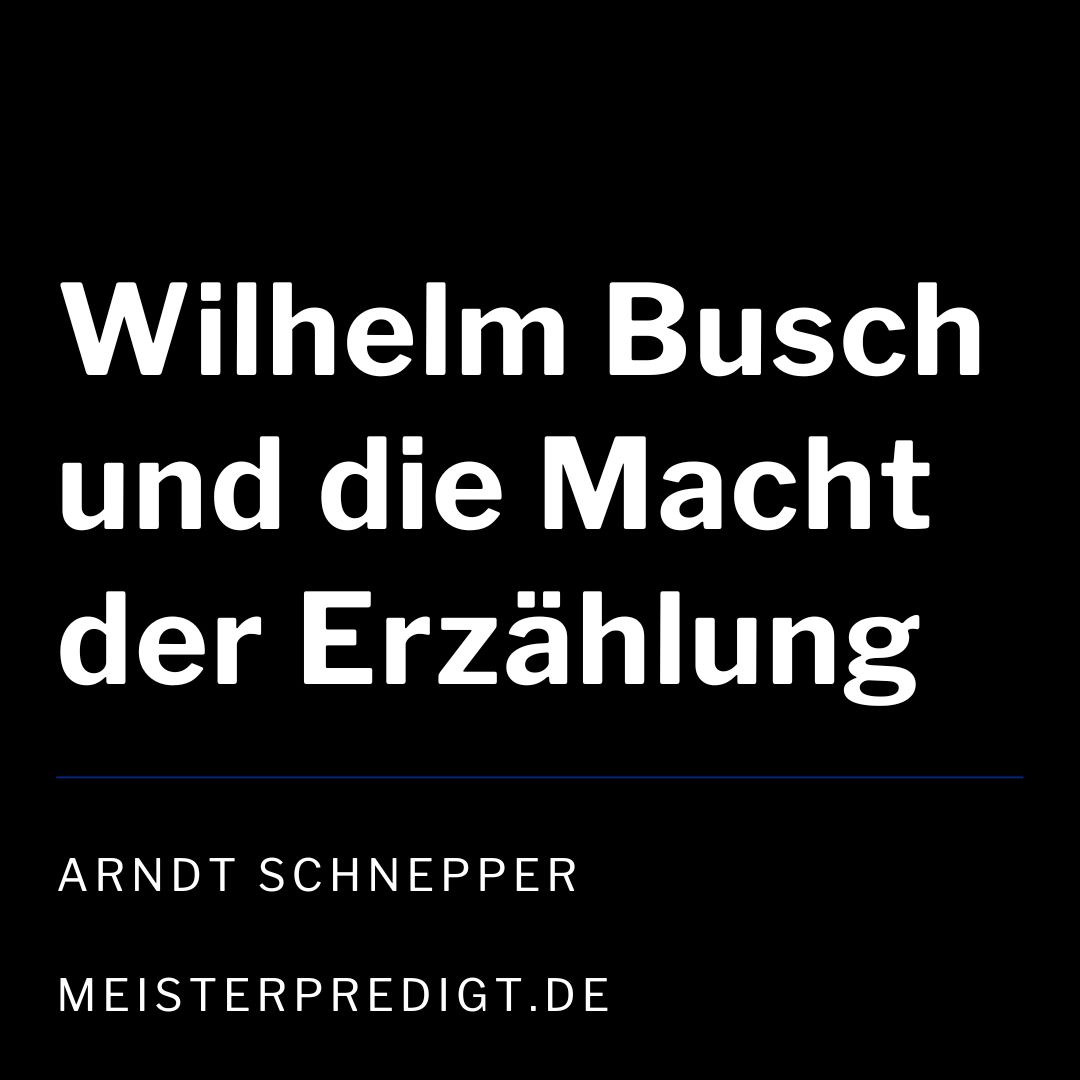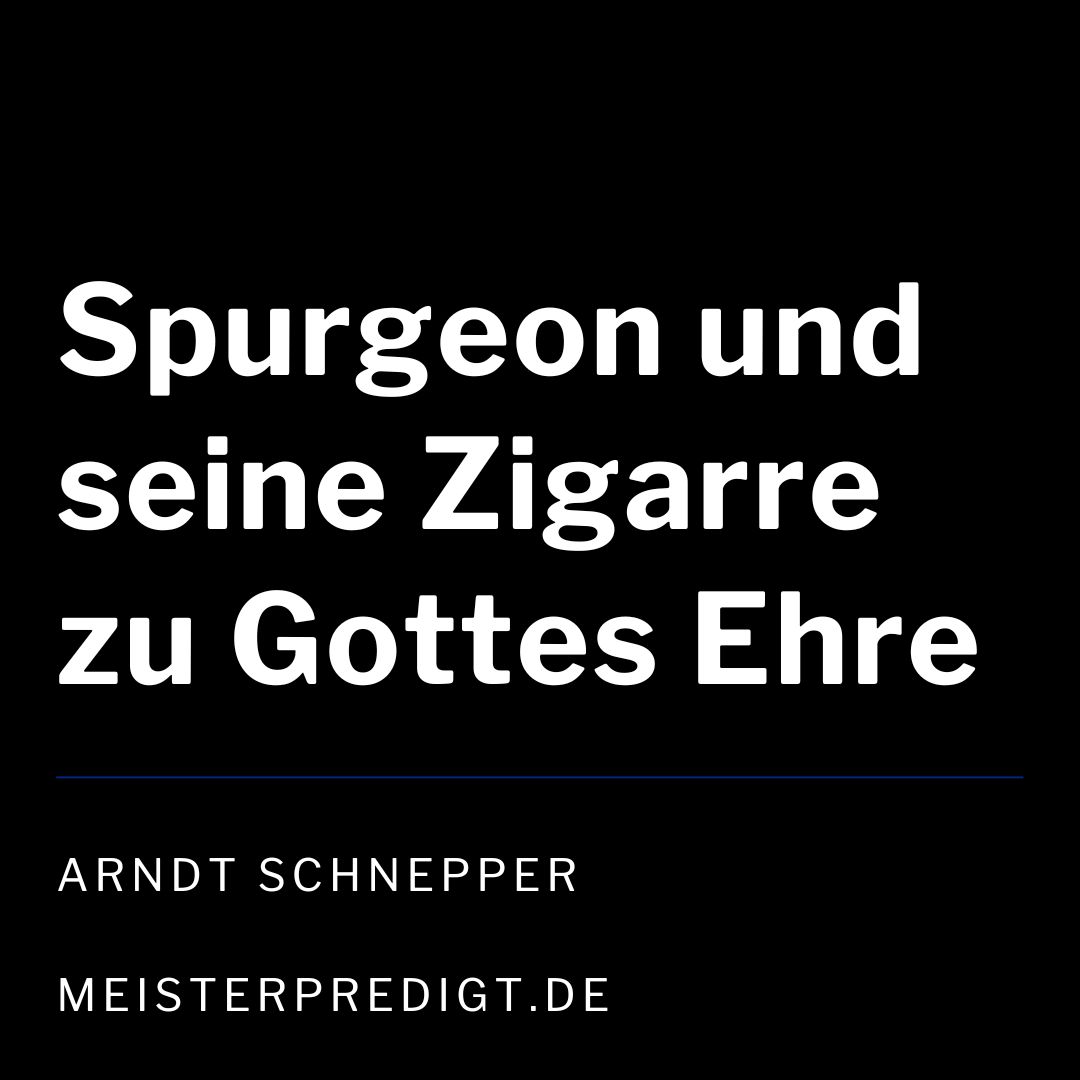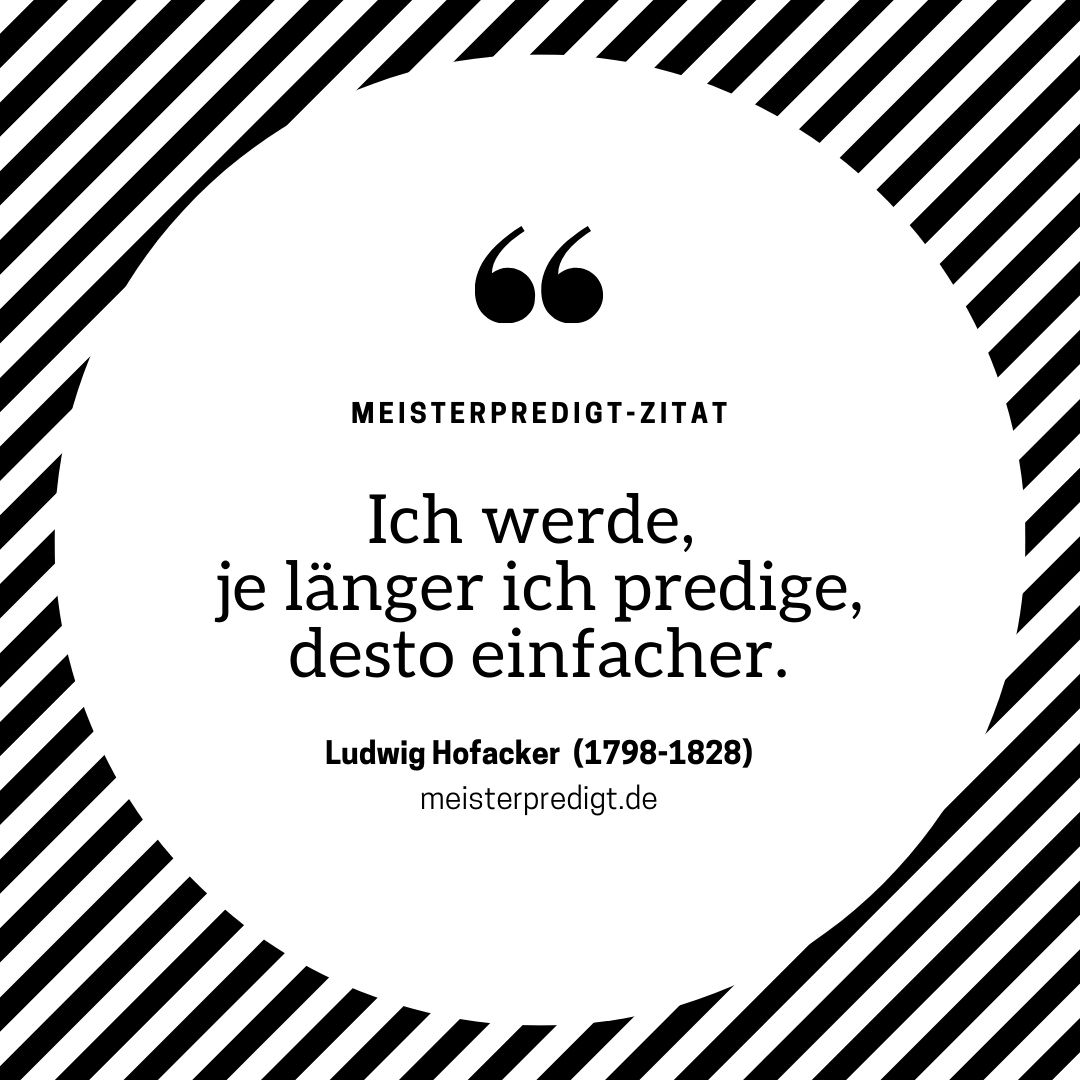Die erste evangelische Predigtlehre erstellte bekanntlich der reformierte Theologe und Marburger Professor Andreas Hyperius (1511-1564). In seinem Handbuch von 1553 erörtert Hyperius die dringende Notwendigkeit, auf die Gefühle – er nennt sie Affekte – der Zuhörer einzuwirken. Ein wesentliches Hindernis empfindet er hierbei in der Verwechslung von Predigt und universitärem Unterricht:
Nicht zuletzt wird der Prediger darauf bedacht sein müssen, Affekte [d. h. Gefühle] zu erregen; denn alle Kundigen stimmen darüber überein, dass er wahrlich keines Dinges mehr bedürfe als dieser einen Tüchtigkeit. Die, welche im Gotteshause nicht anders lehren, als die Professoren in der Universität zu lehren pflegen, können niemals erhebliche Geistesfrucht erzeugen; und man findet sehr wenige oder doch nur einige, die durch solche Predigten zur Sinnesänderung oder zur Besserung ihres Lebens sich führen lassen. Deshalb wird jeder, der in der Kirche einmal ein Lehramt übernommen hat, Tag und Nacht darauf aus sein müssen, doch endlich mal des innewerden zu müssen, dass er in dieser Hinsicht etwas leisten könne. (Hyperius 1901, S. 75)
Die Ausführungen verdeutlichen das bisher Gesagte. Der Klassiker der evangelischen Predigtlehre erklärt die Fähigkeit, Gefühle zu erwecken, zur Grundvoraussetzung für eine gute Predigt. Ohne sie sei nur wenig Segen zu erwarten. Gewarnt wird im selben Zug ausdrücklich vor der sachlichen Redeweise der Akademiker. Der Grund ist offensichtlich: Bei Schule und Gottesdienst bzw. Katheder und Kanzel handelt es sich um zwei durch und durch verschiedene Systeme. Während die sachliche Analyse in der Lehre unumgänglich und oft beherrschend ist, kann sie in der Predigt zur Falle werden. Die Predigt ist eben kein Vortrag und keine Vorlesung, sondern eine Rede ganz eigener Prägung. Sie ist eine eigenständige Kommunikationsgattung mit eigentümlichem Profil. Sie kann im Gegensatz zur akademischen Vermittlung – so Hyperius – auf die Erregung der Gefühle keinesfalls verzichten.
Zum Weiterlesen: Andreas Hyperius, Die Homiletik und die Katechetik. Verdeutscht und mit Einleitungen versehen von Ernst Christian Achelis und Eugen Sachsse, Berlin [1553] 1901.